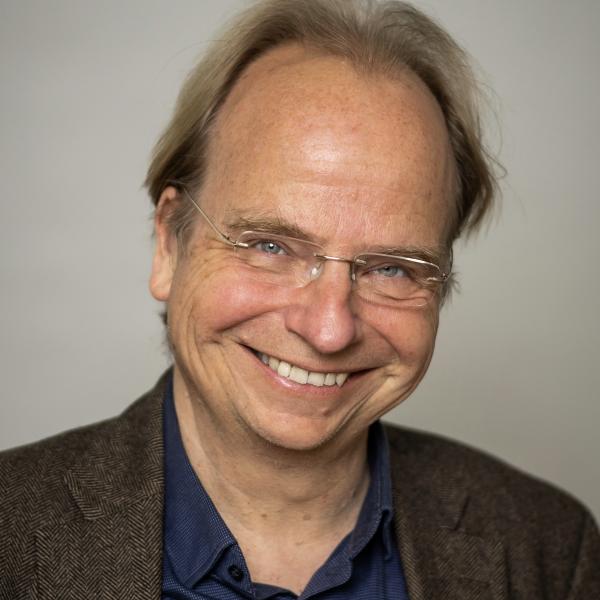Der Fokus auf ein einzelnes Jahr erlaubt eine ungewöhnliche Intensität der Recherche und der Genauigkeit im Umgang mit zeitgeschichtlichen Kontexten. Zugleich ist er sozusagen ein historiographisches Experiment: Während Musikgeschichtsschreibung sonst relativ großzügig über ganze Epochen, Gattungen oder Stile hinweggeht, nähern wir uns hier einer Perspektive, die dem „Nacherleben“ vergangener Welten relativ nahe kommt. Zum Beispiel ließe sich rekonstruieren, was man an einem beliebigen Tag in einer Stadt wie Berlin, Paris oder St. Petersburg im Konzert hören konnte – oder in der Oper, im Variété-Theater und im Ballhaus. Ein bestimmter historischer Moment verdichtet sich gleichsam zum „Hörbild“.
Damit sind eine Reihe interessanter methodischer Konsequenzen verbunden: Zum Beispiel ist klar, dass ein „Hörbild“ nicht Kompositionsgeschichte alleine umfasst, sondern ebenso Stationen der Geschichte musikalischer Interpretation. Auch gehören zum „synchronen Schnitt“ gleichermaßen „High“ und „Low“, ernste und unterhaltende Musik – unerwartete Allianzen und Übergänge zwischen den Sparten inbegriffen. Die Perspektive der Gleichzeitigkeit zwingt den Historiker, Musik mit politischen und kulturgeschichtlichen Situationen, auch mit Entwicklungen in den anderen Künsten zusammenzudenken. Und die radikale zeitliche Beschränkung erlaubt es andererseits, räumlich möglicherweise weit entfernte Schauplätze und Ereignisse in Beziehung zu setzen.
1913 war ein besonderes Jahr, wenn man so will: eine „Sternstunde“ der musikalischen Avantgarde. Dafür stehen Namen wie Claude Debussy, Alexander Skrjabin, Arnold Schönberg, Charles Ives, Igor Strawinsky, Alban Berg, Lili Boulanger und viele andere, die in diesem Jahr Schlüsselwerke schrieben bzw. zur Aufführung brachten. Aber wie kam eine solche Verdichtung zustande? Oder handelt es sich um einen rein illusionären Effekt, geschuldet der „selektiven Wahrnehmung“ bisheriger Musikgeschichten? Und wie haben andere Beteiligte das Jahr 1913 erlebt?
„Echoraum 1913“ behandelt Phänomene der Avantgarde, der musikalischen Alltagsgeschichte und (in Ausschnitten) der außereuropäischen Musik: Komposition und Interpretation, spektakuläre Highlights und etabliertes Repertoire, internationale Stars, Außenseiter und Entwicklungen im Verborgenen. Bekanntermaßen sind aus dem untersuchten Zeitraum nicht nur schriftliche Quellen, sondern auch Tondokumente, Fotografien, ja sogar Filme erhalten. Damit sind auch besondere Chancen – und Herausforderungen – an die Darstellung verbunden. Zu fragen ist auch, wie der Chronist von 1913 mit dem Wissen um 1914 umgeht, d.h. dem Bewusstsein, kulturelle Welten zu beschreiben, die dem Untergang geweiht sind.
Geplant ist eine größere monographische Veröffentlichung und eine Reihe von kleineren „Satellitenprojekten“ im näheren thematischen Umkreis.
Kontakt: Prof. Dr. Andreas Meyer
Bisherige Veröffentlichung zum Thema:
- Andreas Meyer, „Im Echoraum. Europäische Musikgeschichte 1913“, in: Die Tonkunst 7 (2013), S. 162–169.
- „Der Komponist Herwarth Walden. Eine musikalische Spurensuche im ,Sturm‘“, in: Irene Chrytaeus-Auerbach/Elke Uhl (Hrsg.), Der Aufbruch in die Moderne: Herwarth Walden und die europäische Avantgarde (Kultur und Technik 24), Berlin 2013, S. 137–155.
- „Disrupted Structures: Rhythm, Melody, Harmony”, in: Hermann Danuser/Heidy Zimmermann (Hrsg.), Avatar of Modernity. The Rite of Spring Reconsidered, London 2013, S. 102–129.
- „Bartók in Biskra/Algerien“, in: Béla Bartók. Themenheft Musiktheorie 30 (2016), Nr. 4, S. 323–344.
- „Schöne Barbarei? Europas musikalische Avantgarde im Ersten Weltkrieg“, in: Jahrbuch des Staatlichen Institus für Musikforschung 2017, hrsg. von Simone Hohmaier, Druck i.Vorb. (erscheint vorauss. 2018).
- „Was heißt: soziale Dechiffrierung der Musik? Weberns Orchesterstücke und der Kanonendonner von Verdun“, in: Wolfgang Fuhrmann (Hrsg.), Zuständigkeiten der Musik-soziologie? Bericht vom Symposium der Fachgruppe Soziologie und Sozialgeschichte der Musik im Rahmen der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung, Mainz 2016, Druck i.Vorb. (erscheint vorauss. 2018).